Futopia: Was ein Buch bewirken kann
Alina Schwermer
· 10.05.2023
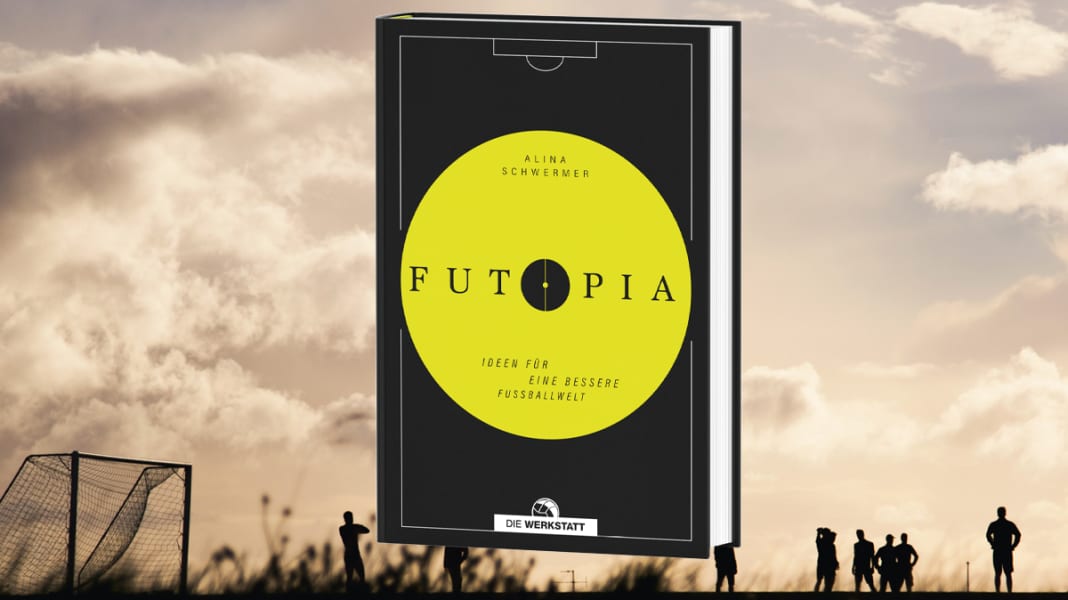
von Alina Schwermer
Wenn ich zwei Momente finden müsste, die die Gefühle zu „Futopia“ abbilden, fällt mir zuerst eine Lesung in Salzburg ein. „Der Analyse würde ich zu fast hundert Prozent zustimmen“, meldete sich da sinngemäß ein älterer Herr. Es ging, glaube ich, um eine Wirtschaftskritik am Fußball, um neues Wirtschaften und neue Spielformen. „Aber diese Vorschläge, das will doch keiner. Die sind doch anmaßend, die instrumentalisieren den Fußball. Wir wollen unseren Fußball, wie er ist. Die Probleme gibt es, aber die muss man mit kleinen Reformen lösen.“ Es sind Sätze, die ich in Variation hunderte Male gehört habe. „Das geht doch nicht“ und „Das will doch keiner“. Ich würde sagen, sie sind mehrheitsfähig unter männlichen deutschen Fans. Übersetzt: Da kommt eine Intellektuelle (Frau!) mit netten Träumen, die keine Ahnung von der Praxis hat. Daraufhin meldete sich ein Sozialarbeiter, der sich erinnerte, mal eine sehr lustige Fußballvariante mit menschlichen, also beweglichen Torpfosten gespielt zu haben. Und plötzlich war die Utopie real. Und eine emotionale Diskussion in Gang gesetzt, was sich verändert, wenn man Fußball verändert.
Bevor ich Utopien für einen besseren Fußball entworfen und gesammelt habe, kannte ich nur die höfliche Form der Buchdebatte. Mit meinem ersten Buch „Wir sind der Verein“ über fangeführte Klubs hatte ich vielleicht fünf Lesungen insgesamt, auf denen stets ähnliche drei Nachfragen gestellt wurden. Ehrlicherweise war ich heilfroh drum, denn ich hatte vor allem Sorge, dass ich eine Antwort nicht wüsste oder jemand das Buch nicht mögen würde (manche mochten es trotz aller Mühen nicht). War ein gutes Buch nicht das, was andere dafür hielten? Ich brauchte ein paar Jahre und das achselzuckende Verblassen von „Wir sind der Verein“, um zu merken, dass diese Haltung nicht sehr klug war. Ich hatte uns allen unbewusst serviert, was wir hören wollten: Schöne Geschichten über romantische kleine Klubs gegen die Windmühlen des Systems. Bewirken taten die systemisch rein gar nichts, die Erzählungen forderten auch niemanden heraus, und alle gingen zufrieden nach Hause. Musste man nicht stattdessen die Windmühlen abbauen? Aber wollten Leute so etwas hören?
Sie wollten, und viel mehr, als ich erwartet hatte. „Futopia“ bekam ziemlich viele Lesungen im In- und Ausland, Interview-Auftritte, Podien, eine Buchpreisnominierung, eine norwegische Übersetzung. Und es rief Begeisterung wie Spott hervor und provozierte so, dass die Leute glücklicherweise vergaßen, höflich und passiv zu sein. Wenn man Zukunft mit konkreten Konzepten diskutiert, die auffordern, sich daran abzuarbeiten, lernte ich, wagt auch das Publikum etwas. Aber es gab, wie exemplarisch in Salzburg, auch ein Dilemma: Dass das aktuelle System nicht funktioniert und nicht funktionieren kann, haben viele zumindest halb durchschaut. Der Leidensdruck ist hoch, unzufrieden mit dem Fußball ist nach meinem Eindruck eine echte Mehrheit. Doch gleichzeitig glaubt kaum jemand an Veränderung. Und eigentlich will man sie auch nicht haben – alles soll bitteschön bleiben, wie es ist, aber wieder gut funktionieren. Wir sind es nicht gewohnt, über Utopien zu sprechen, erst recht nicht im Fußball. Wir sind es nicht gewohnt, dass jemand kommt und am grundlegenden System und Glaubensgerüst sägt. Plötzlich den Horizont zu sehen, löst etwas aus in Menschen.
Die zweite Situation, an die ich oft denke, war in Berlin. Ein ganz anderes Publikum in einer linken Buchhandlung, hinterher kam ein eher junger Typ zu mir. „Ich mache mir viele Gedanken über besseren Fußball“, sagte er sinngemäß. „Aber so radikal habe ich das noch nie gemacht. Und als du geredet hast, wurde etwas in mir wütend: Was machst du mit meinem Fußball? Da habe ich gemerkt, wie sehr ich von dem Fußball geprägt bin, den ich selbst kritisiere.“ Auch dieses Statement habe ich abgewandelt immer wieder gehört. Veränderung wird im Fußball grundlegend noch nicht funktionieren, denn es fehlt noch an eigenem Horizont. Ich glaube, die Reaktion auf diese Horizonterweiterung – mal Empörung, mal Begeisterung, mal Skepsis, mal Gelächter – ist die ehrlichste Form von Bildung. Die Wut, mit der man Gewissheiten verteidigt, bevor sie kollabieren. Oder daran festhält. Manchmal bekomme ich persönliche Nachrichten zu dieser Horizonterweiterung. „Wir haben es uns so bequem gemacht in unserer Opposition, dass wir schlampig im Denken werden“, schreibt mir jemand. „Was du erzählst, ist das Spannendste zum Thema Fußball, das ich kenne.“ Ein Moderator berichtet, wie „Futopia“ emotionale Debatten in seiner Freundesclique anstieß, eine Journalistin konfrontierte nach der Lektüre den eigenen Partner zu seiner Fußballattitüde. Es passiert etwas: Wir fangen an zu reden.
Interessant ist, worüber Menschen reden wollen. Eine utopische Lesung soll auch eine sein, die keine Routine wird, also entscheiden die Gastgeber:innen, über welche Themen wir reden. Das vielleicht erwartbar populärste Thema: Mitsprache und sogenannte Kommerzialisierung im Fußball. Etwas überraschender finde ich das mit Abstand zweitbeliebteste Thema: Klimakatastrophe. Es gab ein hohes Bedürfnis, ganz konkret darüber zu sprechen, was man als Klub oder Fanszene unternehmen kann. Und relativ hoch im Kurs standen – wirklich überraschenderweise – Feminismus und Gleichberechtigung. Die gute Nachricht also: Es gibt ein massives Bedürfnis, Alternativen zu entwerfen. Die schlechte Nachricht: Hoffnung gibt es wenig. Oft zerfranste die Debatte in Details und blieb oberflächlich. Auf einer Lesung in Rostock, wo ein Fan meinen Vorschlag klug zerpflückte, erwiderte ein anderer: „Jetzt kritisier doch nicht direkt, das sind halt Utopien.“ Anders gesagt: Eine fröhliche Spinnerei. Es fehlt vielen noch die Fähigkeit, Alternativen als neue Modelle ernst zu nehmen.
Denn ist nicht aller Grundsatzprotest im Fußball gescheitert? „Die Leute wollen Ideen, die jetzt konkret etwas bewirken“, hieß es in Babelsberg. Gerne hören viele Vorschläge zu autoverkehrsfreien Zonen am Spieltag oder veganer Bratwurst. Weniger gern solche über Fußball miteinander statt gegeneinander, über neue Belohnungsmodelle, Galaxien statt Pyramidensystem oder Beitragsökonomie. Fast 35 Jahre nach dem „Ende der Geschichte“ ist die Gesellschaft weiterhin verbissen überzeugt, dass alles immer so weitergehen wird. Ihre Fixierung auf die kleinen, erreichbaren Kämpfe ist nachvollziehbar, aber sie ist auch ein großer Teil des Problems. Wer nur kleine, sofort umsetzbare Ideen will, die am besten auch noch Geld sparen, wird nichts grundlegend verändern. Und wenn diese kleinen Ideen dann absehbar nichts grundlegend verändern, folgt die Bilanz: „Man kann eben nichts grundlegend verändern.“ Wir haben noch gar nicht richtig damit angefangen.
Und doch gibt es die Leute, die das tun. Sie begegnen mir überall, und dieses Schneeballprinzip ist überwältigend. Ich habe auf Lesereisen viele kleine, überragende Fußballprojekte kennengelernt, von denen ich nie gehört hatte. Es gibt mehr Bewegung im Fußball, als Medien abbilden, und es gibt Leute, deren Weltbild durch sie verändert wurde. Diese Orte gilt es zu vernetzen. Bildung muss erst zugänglich werden, aus Bewegung muss erst Dynamik werden, bevor Revolution möglich ist. Am offensten für Wandel waren oft die Menschen, die am wenigsten von Leistungsfußball geprägt waren. Und über sie sind manche Ideen aus „Futopia“ in die Realität gewandert. Wie bei der Trainerin beim SCJ Hövelriege, die ankündigte, kooperative Spielformen ins Training einzubringen. Wie beim Trainer in Münster, der guten Beitrag statt nur Geld zu einer Währung im Team machte. Wie beim Trainer in Magdeburg, der die Kinder Fußball mit selbst erfundenem Ziel und mit drei Teams gegeneinander spielen ließ. Oder beim Lehrer, der „Belohnung für Beitrag statt Klicks“ im Leistungskurs diskutierte und alternative Spielformen anwendete. Das ändert noch rein gar nichts im Großen, aber es setzt Impulse gegen die gängige Erzählung.
Oft sind die Widerstände groß, und Utopie bedeutet Versuch und Neuversuch. Der Trainer in Magdeburg erzählte mir, dass Fußball mit selbst erfundenem Ziel bei den Kindern schlecht funktionierte, bei Student:innen dagegen gut. Am Dreiseitenfußball hatten die Kinder hingegen viel Spaß. Der Lehrer schrieb mir, dass es bei Jungs, die so auf konventionellen Leistungsfußball geprägt seien, sehr schwer sei, die Perspektive für etwas anderes zu öffnen, es sei im Spitzenfußball auch nicht gewollt. Aber er bleibe dran. Und ein Fan aus ländlichem Gebiet glaubte, dass eine „Futopia“-Veranstaltung auf dem Dorf gar nicht möglich sei; die Leute würden mit so wenig konfrontiert, da müsse erst ein Boden bereitet werden, um nicht nur Gelächter zu ernten. Oft ist der Stand der Dinge frustrierend. Gerade bekannte „alternative“ Klubs blieben interessanterweise oft gleichgültig. Große Veränderung wird nur mit großem Einsatz erreichbar sein, wenn überhaupt. Aber was ist die Alternative in diesem absurd unklugen, ungerechten System, als es zu versuchen?
Dazu gehört es, zu diskutieren. Auch mit Fans, die auf dem Stand beharren: „Der FC Bayern hat seinen Status ja wohl fair verdient.“ Auch ergebnislos. Dazu gehört es, hinzunehmen, dass eine halbe Stunde nach der Lesung alle wieder über den nächsten Spieltag reden und nicht gerade Pläne für die Revolution schmieden. „Ich habe gelernt, bei Veränderung geduldig zu sein“, schreibt mir ein Kollege. Das will ich auch. Dazu gehört aber auch, endlich und viel radikaler Strukturen anzugehen. Wir brauchen einen Ort, an dem Utopie entwickelt wird. Wir brauchen detaillierte Konzepte für einen postkapitalistischen Sport und Wege dorthin. Wir brauchen viel mehr Druck auf die Verbände oder besser neue Institutionen. Und kritische Bildungsmaterialien, die eine relevante Masse erreichen. Das Gute an „Futopia“: Es hat ein paar Leute zusammengebracht, die das auch wollen. Mal schauen, was daraus wird. „Futopia“ hat dafür gesorgt, dass ich ein Jahr nach seinem Erscheinen mehr über Utopien rede, als ich je erwartet hätte. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen.